Dolny l¹sk - dziedzictwo przesz³oci utrwalone w zabytkach
Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt
Lower Silesia - inheritance of the past in remains
Sieroszowice
- powiat polkowicki
vor 1945
Kunzendorf
- Kreis Glogau






Koció³ p.w. w. Piotra i Paw³a
wzmiankowany by³ ju¿ w 1350 roku. Obecny budynek pochodzi z XVI wieku. W czasach
reformacji przechodzi w rêce ewangelików i s³u¿y im do 1654 roku, kiedy to na
powrót staje siê u¿ytkowany przez katolików. Przebudowie uleg³ w XVI wieku a
restaurowany by³ w latach 1910 i 1958. Gotycki w architekturze, jednonawowy,
murowany z kamienia polnego, otynkowany. Zbudowany na rzucie prostok¹ta, od
zachodu wie¿a na rzucie kwadratu, od pó³nocy przybudówka mieszcz¹ca na parterze
zakrystiê i kruchtê a na piêtrze emporê otwieraj¹c¹ siê do nawy dwoma szerokimi
arkadami. Schody na emporê prowadzi³y kiedy w zachodniej cianie kruchty -
jednobiegowe. Wyposa¿enie wnêtrza pónobarokowe i rokokowe z XVIII wieku.
Najstarszy element wyposa¿enia to chrzcielnica pochodz¹ca z prze³omu XIII i XIV
wieku. Kilka kamiennych p³yt nagrobnych przedstawicieli rodów von Braurs i von
Loss. Oprócz gotyckiego dzwonu, na wie¿y znajduj¹ siê tak¿e dzwony pochodz¹ce z
czêciowo zniszczonego w czasie II wojny wiatowej i rozebranego póniej
kocio³a ewangelickiego.

Obok kocio³a stoi dzwonnica stoj¹ca niegdy ko³o wi¹tyni
ewangelickiej.

Wnêtrze wi¹tyni kryje ulokowan¹ na cianie niezwykle
interesuj¹c¹ p³ytê w jêzyku polskim !!!
Zygmunt z Urbanowa
Urbanowski
herbu Prus
dziedzic
Kunzendorfu
ur. 10. Sierpnia
1844. um. 22. Maja 1905.
Prosi o modlitwê.
Obok kolejna p³yta
powiêcona ¿o³nierzom poleg³ym na frontach I wojny wiatowej a pochodz¹cym z
Sieroszowic.
Georg Kubon
14.03.16
Paul Salomon
16.12.16
Paul Guhn
22.09.17
Alfred Walter 14.10.18



Klasycystyczny pa³ac zosta³
zbudowany na miejscu poprzedniego w 1798 roku dla rodu von Eckartsberg. Ca³oæ
za³o¿enia nale¿a³a w 1680 roku do Hansa Ernsta von Schkopp. Inny odnotowany
w³aciciel to ród von Lippe. Autorem projektu pa³acu by³ prawdopodobnie
Christian Valentin Schultze.



W p³ycinach w elewacji pó³nocnej
i po³udniowej umieszczono p³askorzeby przedstawiaj¹ce staro¿ytne bóstwa.

Fragment zabudowy gospodarczej
dawnego maj¹tku.

Hochzeit von
Gerhard und Johanna Silomon-Pflug am 6. April 1929 auf Gut Kunzendorf Kreis
Glogau ( Schloss ) im Speisesaal.
Sitzend:
Martha Rissmann, Oskar
Rissmann(Brautvater) Elisabeth Silomon (Mutter v. Bräutigam, lebte zeitweise mit
im Schloss) das Brautpaar, Helene Rissmann (Brautmutter) Amtsrat
Harrer(Vorbesitzer von Gut Kunzendorf von ? bis 1926).
Stehend:
Ursel Rissmann, Frau Sander, Poldi
Pohl (zu der Zeit Besitzer vom Nachbargut Greif )Gertrud Ingenbrand (Schwester
des Bräutigams, lebte zeitweise mit auf Gut Kunzendorf) Gerda Martin, Peter
Rissmann, Ilse Heckenmann, Walter Heese, Wirtschaftsinspektor Gustav Luschert
auf Gut Kunzendorf, Jutta Pohl (Ehefrau von Poldi Pohl, Gut Greif) Frau Luschert,
Paula Müller (Frau von Dr. Hans Müller) Wichart Schwarzlose, Herr Sander.
2. Reihe: Gerhard
Ingenbrand, Dr. Hans Müller (Arzt aus Polkwitz) Lotte Schwarzlose, Wilhelm
Rissmann. Blumenkinder sind Sohn und Tochter vom ersten Traktorführer auf Gut
Kunzendorf Johann Jakubek.

Hochzeitszug am gleichen Tag auf dem
Weg vom Schloss zur evangelischen Kirche, welche leider nicht mehr steht:
Angeführt vom Kunzendorfer Kriegerverein, der Fahnenträger ist Adolf Karschunke
aus Kunzendorf, die Kinder von Johann Jakubek aus Kunzendorf.
Bilder aus dem Besitz der Familie Silomon-Pflug

Gustav Karschunke mieszkaniec
Sieroszowic w wiele lat od czasu niesienia chor¹gwi na wczeniejszym zdjêciu.


Grób Gerharda Silomon-Pflug 1885
- 1934 jednego z ostatnich w³acicieli maj¹tku w Sieroszowicach.
Po nag³ej (w tajemniczych okolicznociach) mierci Gerharda Silomona-Pfluga
maj¹tek w Siroszowicach przejmuje rodzina
Schleswig-Holstein i kolejni bracia.

Johann-Georg Prinz zu Schleswig-Holstein (1911-1941) w³aciciel maj¹tku w latach
1936 - 1941. Zgin¹³ na froncie wschodnim.

Friedrich-Wilhelm zu Schleswig-Holstein (1909-1940) by³ kolejnym na licie ale
zgin¹³ we Francji w 1940 lub w 1941 roku.

Friedrich-Ferdinand zu Schleswig-Holstein (1913-1989) -
jedyny z braci który prze¿y³ wojnê.

Ksi¹¿ê Friedrich-Ferdinand (1913 - 1989) i ksiê¿na
Anastasia zu Schleswig-Holstein (1922 - 1979) z najstarsz¹ córk¹ ksiê¿n¹ Elisabeth zu
Ysenburg ( zu Schleswig-Holstein ) z Glücksburg - obecnie.



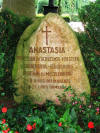
Pomniki nagrobne ksiêcia
Friedricha-Ferdinanda i
ksiê¿nej Anastasji zu Schleswig-Holstein
na cmentarzu w Glücksburg.










































Pozosta³oæ cmentarza
ewangelickiego obok wspó³czesnego.

Budynek dawnej szko³y.


W 1786 roku powsta³a w
Sieroszowicach wi¹tynia ewangelicka. Koció³ o konstrukcji szachulcowej poddano
remontowi w 1862 roku a w trzy lata póniej dostawiono wolnostoj¹c¹ wie¿ê.
Opuszczony w latach powojennych ostatecznie rozebrano. Wspó³czenie na jego
miejscu stoi dom mieszkalny.


Wspó³czesna kapliczka na miejscu po pomniku upamiêtniaj¹cym ¿o³nierz poleg³ych
na frontach I wojny wiatowej a pochodz¹cych z Sieroszowic oraz obelisk
upamiêtniaj¹cy odkrycie z³ó¿ miedzi przez Jana Wy¿ykowskiego. Jest taka wersja
zgodnie z któr¹ odkry³ to miejsce na niemieckich mapach geologicznych.


Popadaj¹cy w ruinê budynek gospodarczy w maj¹tku Nieder
Kunzendorf oraz fragment starej mapy.






Pa³ac oraz zabudowa gospodarcza dawnego maj¹tku, koció³
p.w. w. Piotra i Paw³a, drewniana dzwonnica oraz kapliczka (dawny pomniku upamiêtniaj¹cym
¿o³nierz poleg³ych na frontach I wojny wiatowej).
Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.
Archiwalne widokówki i zdjêcia
Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana
Topografia l¹ska z lat 1744-1768. Skan udostêpni³ autor strony:
http://www.dokumentyslaska.pl/

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische
Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.



















Zdjêcia pochodz¹ z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.
Historia Sieroszowic w jêzyku niemieckim napisana przez
Inge Spiegel geb. Silomon - Pflug
Kunzendorf (Sieroszowice bei Glogau)
Im Jahre 1305 als Conradi villa erstmals erwähnt - später Kunzendorf - mein
Geburtsort in Schlesien. Weit weg, 900 km trennen mich von meinem Wohnort
Isingen (im Schwabenland) von meiner unvergeßlichen Heimat. Immer wieder zog es
mich dahin zurück, seit 1978.
Schon sechs mal haben mein Mann, meine Enkelkinder und ich die weite Reise nach
Kunzendorf unternommen. Immer wieder versuchte ich mir beim Gang durch das Dorf
vorzustellen, wie es wohl früher war, als in den ehemaligen deutschen Gehöften
(in sich geschlossene Bauernhöfe verschiedener Größe, die sich links und rechts
zweier durch den Ort laufenden Hauptstraßen, geteilt durch Ober- und Niederdorf
mit dem Mittelpunkt das landwirtschaftliche Anwesen das Gut) noch ihre
ursprünglichen Bewohner ihrer Arbeit nachgingen und ihr Leben hier verbrachten.
Wie muß dieser Ort vor ca. 60 Jahren geblüht haben. Überall vernahm ich Spuren
Jahrhundert altem Deutschtum der ansässigen Familien, sei es beim Besuch des
alten deutschen Friedhofes mit den verwitterten Grabsteinen, welche teilweise
noch zu entziffern waren. Wesentlich die Bauweise der einzelnen Gehöfte, die
dazu gehörenden großen Scheunen und Ställe, zeugten sie noch nach Jahren, wenn
auch zum größten Teil zerfallen oder notdürftig aufgebaut oder renoviert, vom
Wohlstand der ehemaligen Bewohner.
Die katholische Kirche aus dem 16. Jahrhundert ist mit ihrer alten Bauweise und
ihrer Ausstattung mit dem dazugehörenden Friedhof gut erhalten. Die evangelische
Kirche, ein Bethaus im Fachwerkbau aus dem 18. Jahrhundert, ist abgerissen,
vermutlich von den Polen, da es eine evangelische Kirche war. Vorher wurde sie
restlos geplündert. Die Orgelpfeifen lagen auf der Wiese herum, das Gestühl
vernichtet und die drei Glocken aus dem Turm abtransportiert.
Es sind neue Häuser seit dem letzten Krieg entstanden, jedoch ist die alte
Struktur des Dorfes gut sichtbar. Wie oft habe ich mich gefragt: Wo sind die
Kunzendorfer Familien geblieben? Haben sie die Kriegswirren, die Flucht oder
Ausweisung überlebt!?
Eine deutsch sprechende Polin habe ich bei unseren Besuchen wiederholt gefragt,
ob nicht außer meiner Familie andere Einwohner von Kunzendorf ihre Heimat wieder
aufgesucht haben? Letztes Jahr (2003) endlich eine positive Nachricht, ich
erfuhr von einem Ehepaar Gerhard Pachali, deren Wohnort und Telefonnummer. So
ergab es sich im Laufe der Monate Juni und Juli, daß ich nach und nach einige
Verbindungen zu ehemaligen Kunzendorfern ausmachen konnte. So erfuhr ich nicht
nur Einzelheiten vom Leben auf dem Gut, der Hochzeit und Leben meiner Eltern,
sondern auch - was mir sehr wichtig erschien - von der Nachkriegszeit, Flucht,
Vertreibung und Einmarsch der Russen. Ich will nun anhand der Aussagen
ehemaliger Kunzendorfer, das Schicksal des Dorfes zusammenfassend erzählen, um
dieses unseren Nachfahren zu erhalten. Damit unsere Heimat Schlesien nicht
vergessen wird und in Erinnerung bleibt, vor allem Kunzendorf.
Es ist nicht nur das Dorf mit seiner charakteristischen Struktur eines
Straßendorfes, die Hauptstraße von Polkwitz kommend, beidseits mit alten
Laubbäumen begrenzt, sondern auch die Landschaft mit den großen Wiesen, Feldern
und zum Teil noch sehr alten Waldbeständen, in denen im Spätsommer reichlich
Pilze und Blaubeeren zu finden sind, und im Frühjahr, aus allen Richtungen
kommend, der Kuckucks-Ruf den Spaziergänger erfreut. Dazwischen lässt sich im
Dorf das Klappern der Störche vernehmen. Ungefähr fünf bis sechs Storchennester
mit Jungstörchen haben wir bei unseren Besuchen gezählt. In den nahen
Feuchtwiesen, die sich westlich von Kunzendorf weit ausbreiten, finden die
Störche reichlich Nahrung. Gänse, Hühner, Enten und Katzen sind wie in früheren
Zeiten in den Gärten und auf der Straße oder laufen einem über den Weg.
Spielende Kinder gehören ebenso zu dem Ortsbild wie sich unterhaltende Frauen
und Männer. Es geht heute gemütlich zu in Kunzendorf. Grund ist immer noch die
hohe Arbeitslosenzahl. Trotz der fortschrittlichen Wirtschaftslage in Polkwitz,
wo ein VW-Werk seit ca. drei Jahren mit der Produktion von Dieselmotoren der
Bevölkerung Arbeit und Wohlstand bringt, der aber leider in den Landgemeinden
noch auf sich warten läßt. Nur so ist es zu verstehen, dass die Häuser im Dorf
zum Teil recht traurig dastehen. Mauern, Dächer und Häuser sind teils am
Zerfallen oder brauchen dringend eine Instandsetzung, wozu erhebliche
finanzielle Mittel benötigt werden. Diese höchst notwendigen Mittel hat die
jetzige polnische Bevölkerung nicht, noch nicht. Hoffentlich wird das besser,
wenn Polen im Mai dieses Jahres (2004) in die EU integriert wird. Es tut weh,
sieht man den Verfall der geliebten Heimat von Jahr zu Jahr in größerem Ausmaß.
Jedoch das Land ist und bleibt Schlesien! Die Hügel und Berge, die weite Ebene,
die großen Wälder, Felder und Wiesen. Der Kreislauf der Natur bleibt für immer.
Die Natur trägt hier ihr eigenes typisches Bild - einfach Schlesien. Die Erde,
seit Jahrhunderten von schlesischen Menschen bearbeitet, bepflanzt und geliebt.
Kunzendorf war noch während des zweiten Weltkrieges ein blühendes Dorf. Die
Bauernhöfe hatten eine mittlere Größe und, wie noch heute gut zu erkennen ist,
eine großzügige funktionelle Bauweise für Mensch, Vieh, Ackergeräte und
Lagervorräte. Im Dorf waren bis 1945 noch zwei Gasthäuser mit einem Saal für
Festlichkeiten, Paul Riediger führte gleichzeitig eine Schlachterei. Außerdem
waren ansässig: zwei Tischlereien von Otto Arlt und Willi Karschunke, zwei
Schmieden von Robert Walter und Gustav Karschunke, eine Bäckerei mit Kaufladen
von Alfred Kunze, ein Gemischtwarenladen von Anna Dittmann, eine Sattlerei von
Paul Lissel, der nach Gustav Fiedler viele Jahre Bürgermeister war und 1944
verzog, eine Schneiderei von Alfred Kurz, eine Viehhandlung mit Nutz- und
Schlachtvieh von Herbert Schwerdtner und eine Kohlenhandlung von Fritz Kunze,
der auch als Fleischbeschauer tätig war. Zu erwähnen wäre noch die Spar- und
Darlehenskasse, die von Hermann Niedergesäß geführt wurde. Als Standesbeamter
war Gustav Adam tätig. Bürgermeister war zuletzt Malermeister Martin Dittmann,
Schiedsmann war Fritz Kunze.
Auf dem Gut, welches von 1500 ha Feldmark 500 ha der Gemarkung Kunzendorf für
sich bewirtschaftete und dem jeweiligen Gutsbesitzer gehörte, waren Ende des
zweiten Weltkrieges ca. 30 Arbeiter und Angestellte beschäftigt. Sie arbeiteten
auf dem Gut als Treckerführer, Melker, Ställmacher und ähnliches. Im Schloß
waren ein Diener August Wiesner mit seiner Familie, eine Köchin und vier bis
fünf Hausangestellte tätig. Ebenso sorgten im gutseigenen Garten ein Gärtner mit
Gehilfe für frisches Obst und Gemüse. Für den Wald war ein Förster
verantwortlich. Das Schloß wurde bereits 1795 von dem schlesischen Baumeister
Carl Gotthard Langhans (er stammt aus Landeshut im Riesengebirge) erbaut, der
unter anderem auch das Brandenburger Tor erbaute. Ein Bau, welcher durch seine
stabile Bauweise (die Außenmauern sind ca. 1 bis 1,5 Meter dick) bereits über
zweihundert Jahre der Mittelpunkt von Kunzendorf bildet, und dem dazugehörenden
Gutshof, der wahrscheinlich schon älter ist als das Schloß. So war Kunzendorf in
seiner Gesamtstruktur eine durchaus selbständige Gemeinde mit eigener Feuerwehr,
Hebamme, Schule, Bürgermeister und Gemeinderat.
1926 erwarb Gerhard Silomon-Pflug das Anwesen. Er heiratete zum zweiten Mal.
1930 wurde seine Tochter Inge im Haus geboren und getauft, 1933 wurde seine
Tochter Hannelore im Haus geboren und getauft. Der vom ehemaligen Gutsbesitzer
Gerhard Silomon-Pflug erstellte Kindergarten im Dorf galt als sozialer
Fortschritt. Leider verstarb Gerhard Silomon-Pflug zum großen Leid seiner
Familie und seiner Mitarbeiter schon Anfang 1934, seine Ehefrau führte noch bis
Ende 1936 das Gut weiter, mußte es dann aber aufgrund der schlechten
wirtschaftlichen Lage Ende 1936 in neue Hände übergeben.
Neuer Besitzer war der Prinz Johann-Georg Prinz zu Schleswig-Holstein. Er fiel
1941 an der Ostfront, als Erbe übernahm sein Bruder Friedrich-Wilhelm Prinz zu
Schleswig-Holstein, auch er starb den Heldentod. Der dritte Bruder Ferdinand
Prinz zu Schleswig-Holstein übernahm als letzter Erbe das Gut und mußte Anfang
1945 mit seiner Familie das Gut verlassen. Bis zu dieser Zeit befanden sich Haus
und Hof in guten Händen. Besitzer des Schlosses war 1791 eine Familie von
Eckartsberg, wie lange sie auf dem Gut lebten ist nicht bekannt. Vermutlich bis
das Gut 1862 von Reinhold von Winterfeld bewirtschaftet wurde. Nächster Besitzer
war Siegesmund von Urbanovski, genannt im Jahre 1905. Von ihm zeugt auch eine
Stiftertafel in der katholischen Kirche zu Kunzendorf. 1922 ist ein H. Harrer
als Besitzer eingetragen.
1945 nahm das schwere Schicksal der Gemeinde Kunzendorf-Greif ihren Lauf. Das
wunderschöne gepflegte Dorf ging seinem Untergang entgegen. Die große Flucht der
Bevölkerung aus ganz Schlesien, besonders der Grenzgebiete, hatte bereits Anfang
Januar 1945 begonnen. Die Front rückte immer näher und es war bereits abzusehen,
daß der grausame Krieg seinem Ende zuging. Durchhalteparolen verhallten und die
Bevölkerung traf Vorbereitungen zur Flucht. So auch in Kunzendorf. Anfang 1945
hatte das Dorf Einquartierung. Die Brandenburger Divison (deutsche Wehrmacht)
war kampfbereit und die Einwohner fluchtbereit. Schon kurz nach Weihnachten
1944/45 kam Prinz Ferdinand zu Schleswig-Holstein als Offizier für kurze Zeit
von der Ostfront nach Kunzendorf, machte kund, daß er seine hochschwangere Frau
in Sicherheit bringen würde und forderte weitere Personen auf, sich den
Vorbereitungen zur Flucht anzuschließen. Die Prinzessin, eine Tochter von
Großherzog von Mecklenburg aus Ludwigslust, fuhr mit nur wenigen Personen ab
Kloppschen mit dem Zug in ihre Heimat. Da es seitens des Bürgermeisters noch
keine Aufforderung zur Flucht gab, blieben die Arbeiter und Angestellten des
Gutes und die Bewohner von Kunzendorf bei ihren Aufgaben. Polen, Ukrainer und
Russen waren ebenfalls in Kunzendorf zu finden. Als Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter fristeten sie hier ihr Leben. Gekennzeichnet durch ein Symbol (für
Polen ein Aufnäher PL), Russen und Ukrainer hatten auf einem Dreieck als
Kennzeichen Ost auf ihre Kleidung vermerkt.
Für das Gut waren als Arbeiter ca. 24 bis 25 russische Kriegsgefangene in einer
Feldscheune untergebracht. Diese wurden durch Stacheldraht und nachts durch die
Bewachung invaliderter deutscher Kriegsversehrten gesichert. Tagsüber mußten sie,
wie auch die Ausländer im Dorf, in der Landwirtschaft arbeiten. Man kann nur
hoffen, daß die armen Männer und Frauen menschenwürdig betreut wurden.
Inzwischen rückte die Front immer näher und die Kunzendorfer richteten sich zum
Aufbruch. Planwagen wurden mit Hausrat und Vorräten beladen und die besten
Pferde bereitgestellt. Die Front näherte sich schneller als angenommen. Es ist
anzunehmen, daß die Berichterstattung und Verbindungen innerhalb des Heeres und
der einzelnen Einheiten vielerorts zerstört waren. Wie ist es sonst zu erklären,
daß sich zersprengte Gruppen deutscher Soldaten zu Fuß und motorisiert in Greif
und Kunzendorf befanden.
Unbemerkt standen plötzlich am 8.Februar 1945 (nachmittags) von der Bergmühle
kommend 40 bis 50 russische Panzer an der Hauptstraße Polkwitz Kunzendorf. Sie
schossen blindlings in das Dorf auf Häuser und Dächer. Ein Geschoß landete auch
im Dachstuhl des Schlosses. Deutsche Militärfahrzeuge versuchen vor ihnen zu
flüchten, sie wurden von hinten beschossen, brannten bereits und wurden trotzdem
noch gefahren. Flucht mit dem brennendem Heck in größter Not! Nur wenige
Einwohner von Kunzendorf waren bereits zu dieser Zeit auf der Flucht und der
größte Teil der Bevölkerung war noch im Ort. Sie konnten ihrem harten Schicksal
nicht mehr ausweichen. Angst und Schrecken verbreiteten sich im Dorf. Man rückte
zusammen, denn die Nachrichten die dieser Invasion vorauseilten, waren nicht
sehr ermutigend. Darum war es erstaunlich, daß der Feind die deutschen
Soldaten zum Teil ohne einen Schuß abzugeben vorbeifahren ließ. Am 9.Februar
folgten die Infantrieeinheiten russischer Soldaten der Panzervorhut.
Schützenpanzer mit Flaggwaffen, die die noch vereinzelt im Luftraum befindlichen
deutschen Kampfflugzeuge versuchten abzuschießen. Nach den Infantrieeinheiten
kamen die ersten Versorgungsfahrzeuge für Sprit und Waffen. Nahrungsmittel wie
Fleisch usw. holten sich die Eroberer von den Einwohnern. Auch Stutebecker-LKWs,
eine der modernsten Waffen, die den Russen von Amerikanern geliefert wurden,
gehörten zu den russischen Einheiten. Die Übermacht des Feindes zeigte sich
überdeutlich und es mag manchen auf die Wunderwaffe hoffenden Deutschen
bereits bewußt geworden sein, daß jetzt Handeln angesagt war. Der
Selbsterhaltungstrieb wuchs. Die Führung wurde für viele bedeutungslos,
Selbsthilfe, wenn möglich in der Gemeinschaft, war angesagt. So auch in
Kunzendorf. Die Familien rückten zusammen, bildeten Gruppen in Ober-, Mittel-
und Niederdorf. Sie mußten ertragen, daß geplündert wurde, ein Privileg des
Siegers. Ausgeartet war dieser Zustand sicher auch dadurch (es war sicherlich
nicht beabsichtigt, jedoch leichtsinnig), daß die großen Vorräte der zum Gut
gehörenden Brennerei nicht vernichtet worden waren. Ein willkommener Anlaß für
die russischen Soldaten, sich reichlich mit dem Lebenselixier (Schnaps) zu
bedienen.
Die Folgen waren verheerend. Eine wilde Schießerei im Dorf forderte ein
Menschenleben. Ein vierzehnjähriges Mädchen, Herta Pachali, im Haus der Eltern
auf einer Ofenbank sitzend, erlag einem Kopfschuß durch eine Kugel, welche von
der Straße aus durch das Fenster abgeschossen wurde. Auch Bürgermeister Martin
Dittmann wurde erschossen, ein tragischer Tod. Um seine Ziegen zu füttern, mußte
er vom Haus eine Straße überqueren. Eine Nachbarin sah ihn, wandte sich an einen
Russen mit den Worten das Nazi, das Nazi. Darauf hin wurde er in einen Jeep
geladen und abtransportiert. Wenige Zeit später fand man ihn durch einen
Genickschuß getötet. So wurde indirekt auch eine Kunzendorferin zum Täter.
Die Front verzog sich weiter nach Westen (Richtung Berlin), doch folgten noch
bis Ende des Krieges eine ständige Präsenz der russischen Versorgungsfahrzeuge
in Kunzendorf. Das Leid der Bevölkerung nahm ständig zu, ein Kampf ums Überleben
inmitten der chaotischen Verhältnisse. Die Zwangsarbeiter und gefangenen Russen,
die sich im Dorf befanden wurden abtransportiert. Nicht in die ersehnte Freiheit
zu ihren Familien, sondern nach Sibirien in Lager. Die Begründung seitens
Stalins: Sie hätten als Partisanen kämpfen können. Was muß das für die armen
Menschen grausam gewesen sein.
Die Zeit verging bis zur endgültigen Ausweisung der Deutschen kurz vor der Ernte
1947. Bis dahin vergingen noch viele Monate der Not und Pein. Die Arbeit war
hart. Junge Burschen versorgten die Kühe, welche zusammengetrieben im Oberdorf
standen. Die Felder mußten bestellt werden und die tägliche Arbeit unter
Aufsicht der russischen Besatzung ohne Freiheit gehörte zum Leben. Aber im
Gegensatz zur Bevölkerung in den großen Städte u.a. Glogau, Breslau, Hirschberg
oder Liegnitz, durften die Kunzendorfer, wenn auch eingeschränkt, in ihren
Häusern wohnen bleiben.
Das Schloß wurde weitgehendst geplündert. Hausrat und Möbel zerstört. Ebenso in
späterer Zeit das Försterhaus im Gutshof. Doch wer hat die Gräber auf dem
Friedhof aufgebrochen, und die Toten in ihrer Ruhe gestört? Wer hat die Gruft
meiner Familie im Park aufgebrochen und die Grabplatte entwendet? Wenn sich
schon die Lebenden aus Rache und Gewinnsucht gegenseitig zerstören, so sollten
doch die Toten nicht miteinbezogen werden.
Bis zum Kriegsende waren in Deutschland unzählige Opfer zu beklagen, und als das
Morden vorbei war, begann der Exodus für Millionen deutscher und polnischer
Familien. Die Siegermächte hatten beschlossen, daß die in Schlesien verbliebenen
Deutschen ausgewiesen werden. Polen aus dem Osten Polens mußten zwangsweise ihre
Heimat verlassen und wurden in die verlassenen Häuser, Wohnungen und Gehöfte der
Deutschen eingewiesen. So wurden auf einem Schlag viele Deutsche und Polen
heimatlos. Ob jung oder alt, ohne Rücksicht wurden Familien entwurzelt und ihrer
Heimat beraubt.
Für die Kunzendorfer kam der gefürchtete Tag X kurz von der Ernte 1947. Binnen
einer Stunde kam der Ausweisungsbefehl. Pro Person wurde 50 kg Gepäck erlaubt (genau
gewogen). Menschen und ihre Habe wurden auf Pferdewagen über Wiesau nach
Kloppschen auf den Bahnhof gebracht. Offene Güterwagen brachten die
Ausgewiesenen nach Chemnitz und in andere Städten, wo sie versuchten seßhaft zu
werden. Die Sehnsucht nach der Heimat der eigenen Scholle, war für einige kaum
zu ertragen, waren doch die Familien durch Generationen mit der Heimat tief
verbunden.
Anfang Sommer 1947 begann im Dorf der große Wandel. Kaum waren alle deutschen
bzw. kunzendorfer Familien ausgewiesen, kamen schon die ersten polnischen
Familien und wurden in die frei gewordenen Bauernhöfe in Kunzendorf wie auch in
den Wohnungen der umliegenden Dörfer und Städte eingewiesen. Auch die Polen
waren aus ihrer Heimat vertrieben, aus Ostpolen, das Land wurde Rußland
zugesprochen. So haben die damaligen Weltmächte Amerika, England, Frankreich und
Rußland grausam entschieden. Schlesien wurde polnisch und Millionen Menschen
wurden entwurzelt.
Auch im Schloß zogen Polen ein. Was in den Jahren von 1947 bis 1978 mit dem
Schloß geschah, ist zeitgenau nicht auszumachen. Man spricht von einem
Altersheim und Kindergarten in vergangener Zeit. Das ein Kindergarten im
Untergeschoß war, steht fest, ebenso die Tatsache, daß 1978 der Gutshof als
Kombinat in Betrieb war. In den Ställen standen Vieh die Acker wurden angebaut,
nur sah alles recht marode aus. Der Park war schon verwildert und vom Schloß,
den Ställen und Wohnhäuser fiel der Putz ab. Das Notwendigste wurde in den
Jahren ab 1945 an den Gebäuden instandgesetzt.
In den 90er Jahren sah alles trostlos aus. Die Ställe waren leer, die Fenster
zum Teil ohne Glas, der Hof verwildert. Im Park standen die Brennesseln
meterhoch, es gab kaum ein Durchkommen durch die vielen Sträucher und
überwucherten Bäume. Die Ruine eines Schwimmbads zierte den einstmals großen
Rasen mit Rosenrondell vor dem Schloß.
Sehr gepflegt war alles in früheren Zeiten. Den Park durchkreuzten gepflegte
Wege, im Teich blühten im Sommer Wasser-Iris. Ein großer Gartenpavillon mit
Fasanerie (in dem Gehege wurden Fasane gezogen, welche dann zum Abschuß im
Herbst frei gelassen wurden) ergänzte den Park, der in englischem Stil angelegt
war. Ein großer Gemüsegarten gehörte, ebenso wie die daneben liegende Brennerei
zum Gutsbereich.
Das Schloß, von Carl Gotthard Langhans, der auch das Brandenburger Tor in Berlin
und andere Bauwerke in Schlesien schuf, im Jahre 1791 erbaut, ist mit seiner bis
zu 1,5 Meter starken Außenmauern und 1500 qm Wohnfläche ein imposanter Wohnsitz.
Seit über 200 Jahren für die verschiedenen Besitzer eine beschützende Heimstatt.
Das Schloß hat die wechselvolle Geschichte Schlesiens gut überstanden, bis es
endlich im Jahr 2000 wieder in private Hände kam. Ein Besitzer, der mit viel
Liebe in den kommenden Jahren Haus und Hof in alter Schönheit, Eleganz und
Zweckmäßigkeit wiederherstellt. Sämtliche Gebäude und der Park stehen unter
Denkmalschutz.
Über die Persönlichkeiten vergangener Besitzer ist zu berichten, daß Gerhard
Silomon-Pflug, - er hatte das Gut 1926 übernommen - Landwirtschaft studierte und
starke soziale Ambitionen hatte und auf das Wohl seiner Mitarbeiter großen Wert
legte. So erzählt eine Kunzendorferin, die sich noch gut an ihn erinnern kann,
daß er mit eigenen Mitteln einen Kindergarten erbaute, für Kinder der
Mitarbeiter und auch vom Dorf im Alter von einem bis vierzehn Jahren. Auch
sorgte er dafür, daß während der kälteren Jahreszeit seine Feldarbeiter gut
versorgt waren. So schenkte er unter anderem seinem ersten Treckerführer einen
Pelzmantel zum Schutz gegen die Kälte auf dem Traktor.
Seinen Kindern war er ein äußerst liebevoller Vater, sein früher Tod stürzte
seine Familie und die ganze Belegschaft in Haus und Hof in tiefste Trauer. Seine
letzte Ruhe fand er im Schloßpark. Nach 1945 wurde nach dem Einmarsch der Russen
das Grab zerstört, d.h. die bronzene Grabplatte wurde entfernt und die Gruft
aufgebrochen. Ich habe zusammen mit meinem Ehemann und mit der tatkräftigen
Hilfe des jetzigen Besitzers das Grab 2003 als Gedenkstätte wieder hergerichtet.
Von den nachfolgenden Besitzern von 1936 bis 1945 - den Prinzen von
Schleswig-Holstein - ist wenig bekannt. Sie hielten sich nur zeitweise in
Kunzendorf auf. Ihre Anwesenheit kündigte immer eine gehißte Fahne auf dem Dach
des Schlosses an. Alle drei waren passionierte Pferdeliebhaber - edle Pferde
gehörten schon immer zum Gut.
Der nächste Besitzer nach der Familie Silomon-Pflug war Prinz Johann-Georg zu
Schleswig-Holstein, er fiel 1941 in Rußland. Danach hat sein Bruder
Friedrich-Wilhelm zu Schleswig-Holstein das Gut geerbt. Doch auch er fand kurze
Zeit später den Heldentod in Frankreich.
Prinz Ferdinand zu Schleswig-Holstein als dritter Bruder übernahm Haus und Hof,
jedoch nur für kurze Zeit. Er kämpfte zwar auch als Offizier an der Ostfront,
konnte aber nach Weihnachten 1945 mit seiner Familien nach Glücksburg
übersiedeln. Auch die letzten drei Besitzer waren sehr aufgeschlossen gegenüber
den Belangen der Angestellten und ihrer Mitarbeiter.
Bleibt abschließend zu sagen, daß es mein größter Wunsch ist, daß Friede in
Kunzendorf einzieht und daß Kunzendorf wieder zum Blühen kommt!!
l¹sk - Dolny l¹sk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki
Dolnego l¹ska
Bêdê
wdziêczny za wszelkie informacje o historii miejscowoci, ciekawych
miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjêæ.
Wenn Sie
weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben
sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.
Tomasz Mietlicki e-mail -
itkkm@o2.pl





